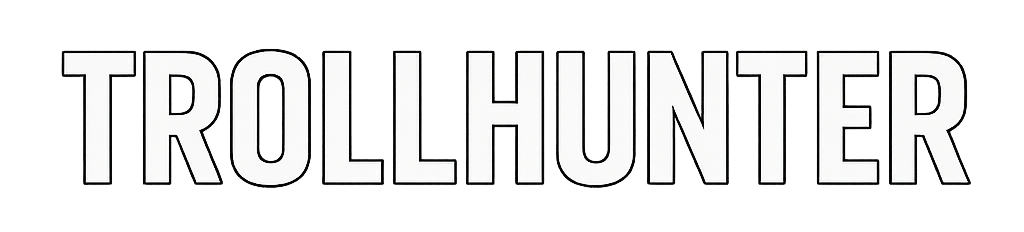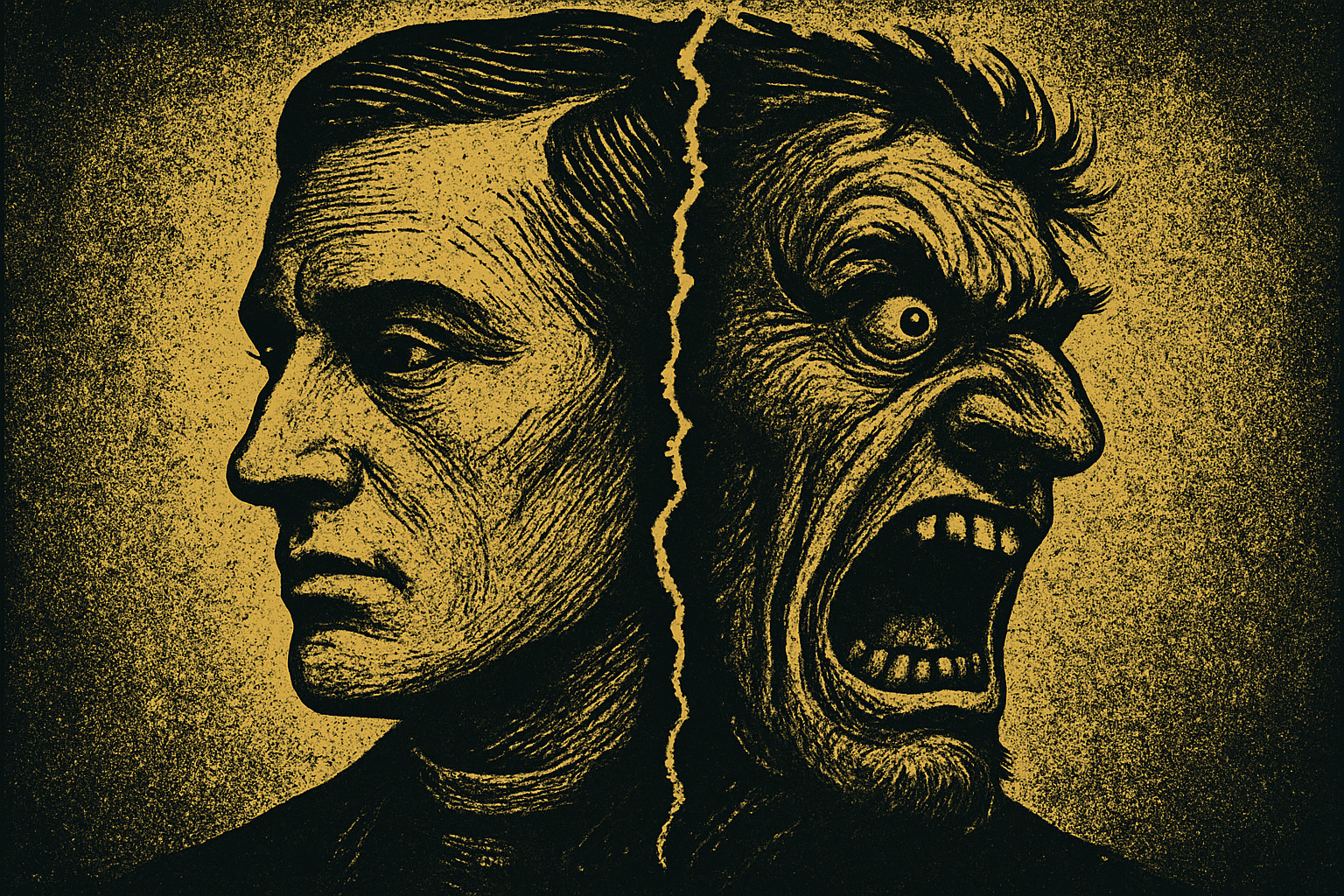Russlands Krieg ist keine Strategie. Er ist ein Reflex. Ein Kränkungskomplex mit Sprengkopf. Und das ist keine Metapher, sondern ein historisches Muster. Der russische Literaturkritiker Wissarion Belinskij hat es Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieben – ohne es zu wollen. Er sah die Rückständigkeit seines eigenen Landes, verglich sie mit dem zivileren Süden, den er damals noch „Malorossija“ nannte – und drehte durch. Nicht gegen die Macht, sondern gegen die Ukraine.
Im Sommer 1846 reiste Belinskij zur Kur in die Nähe von Charkiw. In einem Brief an seine Frau schreibt er: „Ab 30 Werst vor Charkiw beginnt Malorossija. Die Dörfer wie Bauernhöfe. Eine Reinheit, eine Schönheit – unbeschreiblich. Selbst der grüne Borschtsch: sauber, geschmackvoll, von Männern gekocht. Die Kinder schön, die Gesichter offen. Auf Russen kann man nicht schauen. Schlimmer als Schweine.“ So redet kein Romantiker. So redet ein Patriot, der merkt, dass ihm der Boden unter den Füßen moralisch wegschmilzt.
Belinskij war kein Ukrainerfreund. Aber er sah. Und er fühlte: Im „Igorlied“, dem berühmten Heldenepos, steckt nicht der Norden, sondern der Süden – Sprache weich, Ton edel, Frauen nicht Objekt, sondern Subjekt. Die Heldin weint nicht um Brot oder Schutz, sondern um Liebe. Das, sagt er, sei typisch für die südliche Rus’, die später Ukraine heißen sollte. Und eben nicht für die grobe, kalte, autoritäre Nordtradition.
Und dann passiert, was bis heute passiert: Statt zu lernen, schlägt er um sich. Nicht gegen die Leibeigenschaft, nicht gegen die Willkür, nicht gegen den Zarismus – sondern gegen Gogol, gegen Schewtschenko, gegen Kulis. Gogol, der ukrainische Schriftsteller, war für ihn erst „der Einzige, der schreiben kann“ – bis dieser sich in seiner Spätphase kritisch äußert. Dann wird er zum Verräter. Schewtschenko? „Dummer Esel, ordinär, saufender Chochle-Pseudopatriot.“ Und das, obwohl Belinskij zugibt, die Texte nicht gelesen zu haben. Aber sie müssten ja schlecht sein. Müssen. Reicht.
Kulis? „Liberale Sau, gut nur fürs Schmalz.“ Weil er in einem Kinderheft einen Satz veröffentlichte, in dem die Ukraine sich von Russland trennen will – oder untergeht. Die Zensur schlief, die Panik folgte. Und Belinskij, der Klartextkritiker, wurde zum Büttel der Macht: „Hätte ich geurteilt – ich hätte Schewtschenko ebenso verbannt.“
So funktioniert das russische Imperium seit Jahrhunderten. Der Intellekt erkennt die Fäulnis, doch wenn’s ernst wird, schützt er das Zentrum – und trampelt auf den Peripherien. Statt den Sumpf trocken zu legen, beschimpft man den Spiegel.
Und Belinskij beschreibt diesen Sumpf ehrlich. Seine Kindheit in Tambow: Prügel, Hunger, Abscheu. Die Universität: Lärm, Schmutz, Suppe mit Würmern. Der Staat: Menschenhandel, Prügelstrafe mit Dreischwanz, Polizei als Räuberbande. Kein Recht, keine Würde, keine Ordnung – nur ein riesiger Apparat aus Vetternwirtschaft, Gewalt und Heuchelei. Er wusste das. Und doch – wenn jemand wie Schewtschenko genau das benennt, ist nicht das System schuld, sondern der Dichter.
Und Gogol? Der reagierte auf Belinskijs Wutbrief mit Milde. Fast fürsorglich. Sagte ihm, dass sein Wissen oberflächlich sei, sein Urteil zu hitzig, seine Bildung zu schmal. Und dass man Russland nicht verändern könne, wenn man es hasst. Auch das stimmt – und erklärt, warum beide Männer gescheitert sind. Belinskij stirbt verbittert, Gogol an Reue. Und Russland? Zieht den Vorhang zu.
Denn das eigentliche Problem beginnt, wenn man seine eigene Rückständigkeit erkennt – aber nicht rauswill. Sondern sich einrichtet. Im Mythos. In der Beleidigung. Im Spott auf die, die’s besser machen. Das ist heute nicht anders. Die Ukraine ist nicht gehasst, weil sie „Bedrohung“ wäre. Sondern weil sie funktioniert. Weil sie zeigt, dass man anders leben kann. Mit Sprache, die nicht dominiert. Mit einem Staat, der nicht schlägt. Mit einer Gesellschaft, die nicht im Zorn lebt, sondern im Recht.
Daher muss sie zerstört werden. In der Logik des Imperiums. Denn der Kränkungskomplex duldet keine Alternative. Nicht im Osten. Nicht direkt vor der Haustür. Also wird gesprengt, sabotiert, diffamiert. Genau wie früher. Bloß mit Drohnen statt Zensur. Aber die Dynamik ist dieselbe.
Die Frage ist, wie man reagiert. Der Weg der Vernunft ist: Hebel ziehen. Kein Geld mehr für das System (keine Schattenflotten, keine Derivate). Keine Technologie mehr für den Apparat (kein Cloud-Zugriff, keine Dual-Use-Ware, kein Wartungswissen). Und kein logistisches Öl mehr ins Feuer (keine Ersatzteile, keine Rückversicherungen, keine Häfen ohne Kontrolle).
Zugleich: alles tun, um den Spiegel zu erhalten. Ukrainische Normalität ist das, was das Imperium am meisten fürchtet. Und das ist auch das, was uns schützt. Nicht Raketen. Sondern Würde. Der russische Komplex braucht Feindbilder – aber der Westen braucht endlich ein klares Selbstbild. Ohne Naivität. Mit Geschichte. Und mit Belinskij. Denn der hat es gesehen. Und – in seinem Widerspruch – genau das entlarvt, was heute wieder brennt.
────────────
Quellen und Einordnung:
Die Zitate im Artikel stammen aus Belinskijs Briefen von 1846–1847, insbesondere:
– Brief an seine Frau aus dem Charkiwer Umland (Juni 1846)
– Brief an Annenkow vom 10. Dezember 1847 (u. a. über Schewtschenko)
– Brief an Gogol, verfasst im Juli 1847, veröffentlicht posthum im frühen 20. Jahrhundert
– Herzen über Belinskij (Erinnerungen)
Die historische Einordnung folgt u. a. sowjetischen Gesamtausgaben („Pisma“, Band 12, Moskau 1956) sowie der Forschung zur russischen Literaturkritik im 19. Jahrhundert. Die Episode zur Zensur um Kulis’ Text beruht auf dokumentierten Verwaltungsakten des Bildungsministeriums unter Zar Nikolaus I.