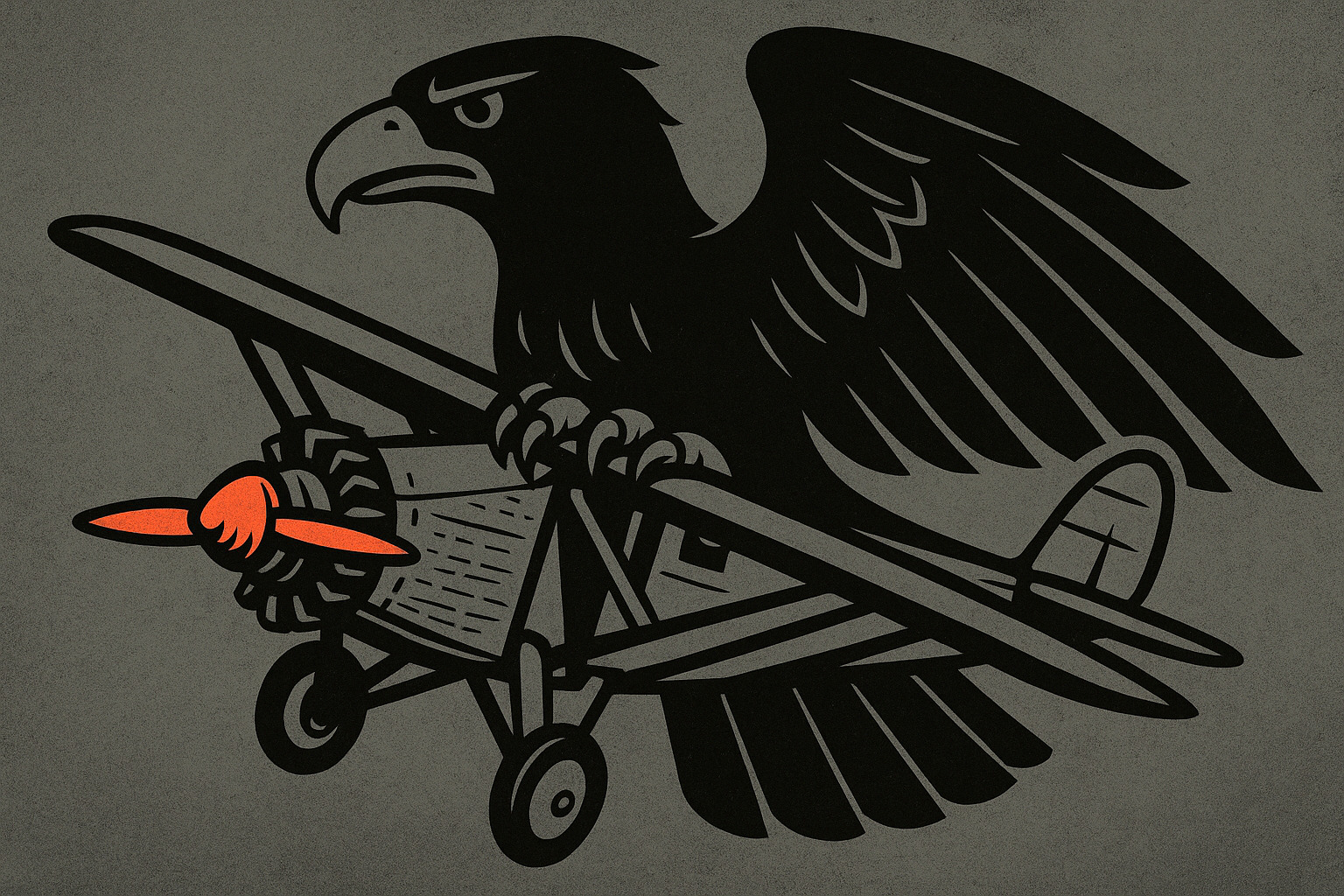Charles Lindbergh war ein amerikanischer Held. Der erste Mensch, der allein den Atlantik überquerte – 1927. Eine nationale Ikone. Verehrt, gefeiert, unantastbar. Und dann wurde aus dem Nationalhelden ein nützlicher Idiot. Einer, der den Faschismus nicht liebte – aber ihn für klug hielt. Einer, der glaubte, man könne Hitler ignorieren, wenn man nur fest genug an Frieden glaubt. Einer, der den Krieg nicht verhindern half, sondern verzögerte – zugunsten der Täter.
Lindbergh war in den Dreißigern viel in Europa. Offiziell, privat, technisch interessiert. Vor allem aber tief beeindruckt von der deutschen Luftfahrt. Er flog Messerschmitt, besuchte Werke, traf Militärs. Und er bekam einen Orden – ausgerechnet vom späteren Kriegsverbrecher Hermann Göring. Der „Deutsche Adlerorden“. Ein faschistisches Schmuckstück für einen westlichen Star. Lindbergh nahm ihn an – ohne Skrupel, ohne Distanz, ohne jedes Bewusstsein für das, was er da legitimierte. Für Berlin war es ein Propagandageschenk. Für die USA ein Skandal.
Doch der eigentliche Schaden begann erst danach. Ab 1940 wurde Lindbergh das Gesicht einer Bewegung, die sich „America First“ nannte. Sie forderte: keine Hilfe für England, keine Einmischung in den europäischen Krieg, keine Aufrüstung. Und sie sagte: Der wahre Feind sitzt nicht in Berlin – sondern in Washington, London und New York. In den jüdischen Medien. In Roosevelts Regierung. In der britischen Propaganda. Lindberghs Reden hallten durch Stadien. Millionen hörten ihm zu. Er sagte, man dürfe nicht England helfen, weil man damit nur Hitler provoziere. Er sprach von Vernunft, von Besonnenheit, von Frieden. Und in Wahrheit sprach er genau das, was Goebbels hören wollte.
Im Juni 1941, wenige Monate vor Pearl Harbor, trat er im Hollywood Bowl auf. Er sagte, die Interventionsbefürworter arbeiteten mit Propaganda – er dagegen kämpfe mit „dem Schwert der Wahrheit“. Er sagte, der Krieg könne nur verloren werden, wenn Amerika sich einmische. Und dann kam der 11. September – 1941, nicht 2001. In Des Moines hielt Lindbergh eine Rede, in der er klar sagte, wer seiner Meinung nach die USA in den Krieg treiben wolle: die Briten, die Juden, und Roosevelts Regierung. Er behauptete, jüdische Gruppen hätten zu viel Einfluss auf Presse, Film und Regierung. Und er sagte, sie müssten den Krieg ablehnen – nicht aus moralischen Gründen, sondern weil sie selbst als Erste leiden würden.
Das war keine Nazi-Rede. Aber es war ein Nazi-Narrativ. Und es kam aus dem Mund eines amerikanischen Volkshelden. Kein Wunder, dass selbst viele Unterstützer danach das Weite suchten. Die Bewegung „America First“ begann zu bröckeln. Und Lindbergh? Wurde beobachtet, kritisiert, aber nie angeklagt. Es gab keinen Beweis, dass er ein Nazi-Agent war. Nur Beweise dafür, dass er exakt das sagte, was die Nazis brauchten. Und das reichte schon.
Nach Pearl Harbor unterstützte Lindbergh den Krieg. Aber das Vertrauen war weg. Er durfte nicht mehr als Offizier dienen, flog nur als Zivilist im Pazifik einige Einsätze. Und Jahre später schrieb er in seinen Memoiren, dass die Ordensannahme von Göring ein Fehler war. Das war’s. Kein echtes Schuldbekenntnis. Keine politische Aufarbeitung. Nur der späte Versuch, das eigene Denkmal zu retten.
Was bleibt, ist die Geschichte eines Mannes, der aus Überzeugung falsch lag. Der glaubte, der Feind liege in der Rüstung, nicht in der Ideologie. Der sich einreden ließ, dass Frieden etwas ist, das man fordern kann – egal, wer einem gegenübersteht. Lindbergh war nicht der Erste und nicht der Letzte seiner Art. Solche Leute tauchen immer dann auf, wenn Demokratien schwach werden. Wenn sie hoffen, durch Nachgiebigkeit Konflikte zu vermeiden. Wenn sie glauben, Moral sei etwas für Friedenszeiten.
Heute sitzen sie in deutschen Parlamenten. In Talkshows. In Redaktionen. Sie sagen: Verhandeln! Nicht eskalieren! Rücksicht auf Russland! Sie fordern „Vernunft“ und „Dialog“, während die Bomben auf Charkiw fallen. Und sie halten sich für klüger als die Geschichte. So wie Lindbergh.
Lindbergh war kein Nazi. Aber er war ein Verstärker. Ein Multiplikator. Ein Mensch mit Reichweite, der sie gegen die Falschen einsetzte. Seine Worte haben keinen einzigen Schuss abgefeuert – aber sie haben die Waffenlieferungen verzögert, die Leben hätten retten können. Seine Reden töteten nicht – aber sie gaben denen Zeit, die genau das taten.
In jeder Generation gibt es solche Figuren. Sie sind berühmt, gebildet, rhetorisch geschult. Und sie sind blind. Blind für das Wesen der Gewalt. Blind für die Lektionen der Geschichte. Sie glauben, ihre Position sei mutig. Dabei ist sie nur bequem. Lindbergh war ihr Prototyp. Ihr Posterboy. Ihr Urbild.
Wer heute Frieden ruft, ohne die Täter zu benennen, ruft nicht nach Lösung – sondern nach Kapitulation. Wer heute von Sicherheitsinteressen spricht, ohne die Vernichtung zu sehen, verteidigt keine Ordnung – sondern zementiert Unrecht. Lindbergh wollte keinen Krieg. Und hat dem Krieg genau das geliefert, was er brauchte: Zeit, Zweifel, Zersetzung.
Das macht ihn nicht zum Monster. Sondern schlimmer: zum Vorbild für die Falschen. Und genau deshalb gehört seine Geschichte nicht ins Luftfahrtmuseum – sondern in jedes Lehrbuch für politische Naivität. Damit wir endlich verstehen: Nicht jeder, der Frieden sagt, meint auch Freiheit.
────────────