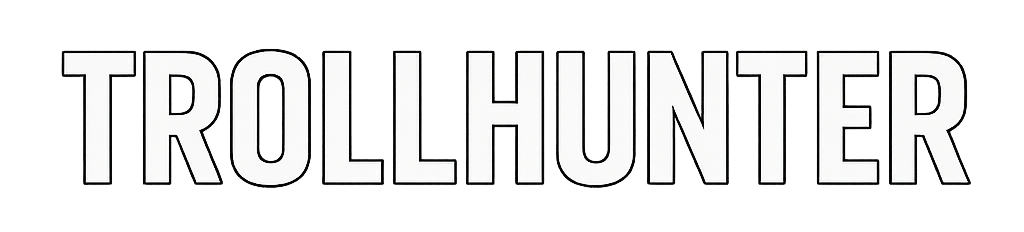170 Milliarden Euro. Eingefroren bei Euroclear in Brüssel. Staatsvermögen der Russischen Föderation. Blockiert vom Westen – aber nicht beschlagnahmt. Die Gelder bleiben unangetastet, obwohl täglich Raketen auf ukrainische Städte fallen. Warum? Weil ein Vertrag mit einem nicht mehr existierenden Staat noch immer mehr Gewicht hat als die Realität eines laufenden Angriffskrieges. Die Sowjetunion ist untergegangen. Ihre Paragrafen wirken weiter.
1989 unterzeichneten die UdSSR, Belgien und Luxemburg ein bilaterales Abkommen zum Schutz von Investitionen. Es garantiert, dass keine der Vertragsparteien Investitionen der anderen Seite enteignet oder beschlagnahmt – weder direkt noch indirekt. Russland hat sich nach 1991 zur Rechtsnachfolgerin der Sowjetunion erklärt. Und genau auf diesen Vertrag berufen sich heute russische Anwälte, um die Konfiskation ihrer Gelder in Europa zu verhindern. Mit Erfolg.
Brüssel hat den Zugriff auf das Geld blockiert, aber nicht freigegeben. Aktuell dürfen lediglich die Zinserträge verwendet werden – das Kapital bleibt unter Schutz. Nicht aus Sympathie für Moskau. Sondern aus Angst vor Klagen. Denn Euroclear ist nicht irgendein Finanzinstitut. Es ist das Rückgrat eines Großteils des globalen Kapitalverkehrs. Dort lagern nicht nur russische Gelder, sondern auch ausländische Anleihen, Zentralbankreserven, globale Fonds. Jede Entscheidung über Konfiskation hat systemische Konsequenzen. Ein Präzedenzfall in Belgien könnte dazu führen, dass Staaten und Investoren weltweit ihre Einlagen aus Europa abziehen. Das Vertrauen in die finanzielle Rechtsstaatlichkeit würde erodieren. Genau darauf zielt Moskaus Strategie ab.
Denn Russland führt keinen Krieg nur mit Raketen. Es kämpft juristisch – mit Verträgen, Strohfimen und Klagearchitektur. Russische Gelder sind oft nicht direkt als staatlich erkennbar. Sie laufen über Trusts in den Niederlanden, Holdings in Luxemburg oder Stiftungen auf Zypern. Formell europäische Firmen, de facto russisch kontrolliert. Sie können Brüssel verklagen – auf der Basis alter Verträge. Der bevorzugte Austragungsort: Genf. Die Schweiz bietet schnelle Verfahren, neutrale Position und effektive Mechanismen zur Sicherung russischer Interessen. Moskau plant keine Gegenoffensive auf dem Schlachtfeld – sondern vor internationalen Schiedsgerichten.
Belgiens Regierung weiß das. Premierminister Bart De Wever fordert, dass die Verantwortung geteilt wird. Keine Einzelfallentscheidung durch Brüssel, sondern eine EU-weite Regelung mit kollektiver Haftung, Garantiefonds und politischem Rückhalt. Die Realität ist: Solange dieser Rechtsrahmen fehlt, bleibt das Kapital blockiert – aber unangetastet. Europa ist handlungsfähig – und gleichzeitig gelähmt.
Historisch war das einmal anders. Im Zweiten Weltkrieg wurden Vermögen feindlicher Staaten nicht nur eingefroren, sondern enteignet und verwendet. Die USA schufen mit dem „Office of Alien Property Custodian“ eine Behörde, die deutsches Kapital beschlagnahmte und es aktiv in den Kriegsverlauf einspeiste. Großbritannien handelte ähnlich – mit dem „Trading with the Enemy Act“. Der rechtliche Unterschied zu heute: Damals galten die Achsenmächte als feindliche Staaten. Ihr Vermögen wurde automatisch zum Eigentum der alliierten Staaten erklärt – nicht aus moralischen Gründen, sondern aus rechtlicher Klarheit.
Im aktuellen Konflikt fehlt diese Einstufung. Russland gilt in der EU nicht als feindlicher Staat, sondern lediglich als Aggressor gegenüber der Ukraine. Das ist völkerrechtlich differenziert – und praktisch folgenreich. Die eingefrorenen Vermögen bleiben unter Eigentumsschutz. Nicht weil es richtig ist. Sondern weil der rechtliche Status fehlt, der Konfiskation erlaubt.
Diese Lücke ist bekannt. Und sie wird genutzt. Russland kalkuliert damit, dass Europa sich an seine eigenen Regeln bindet. Dass alte Verträge über neue Massengräber gestellt werden. Dass Schutzmechanismen für Investoren weiterhin auch für Kriegsverbrecher gelten. Und dass der Rechtsstaat zu langsam ist, um auf systemischen Angriff zu reagieren.
Solange die EU Russland nicht rechtlich dort verortet, wo es faktisch längst steht – als feindlicher Akteur mit globalem Eskalationsinteresse –, bleiben seine Milliarden geschützt. Nicht trotz, sondern wegen der europäischen Rechtsordnung. Der Aggressor wird verteidigt von genau dem System, das seine Opfer schützen soll.
Es braucht keine neue Moral, sondern einen klaren Schnitt. Der rechtliche Status Russlands muss angepasst werden. Der Zugriff auf blockiertes Kapital darf nicht länger durch Verträge mit einem toten Imperium verhindert werden. Andernfalls bleibt Europas Finanzsystem ein sicherer Hafen für den Krieg – und ein blinder Fleck im eigenen Verteidigungskonzept.
────────────
Quellen und Einordnung:
Bericht der Corriere della Sera über den sowjetisch-belgischen Investitionsschutzvertrag von 1989 und die aktuelle Debatte in Brüssel um die Nutzung eingefrorener russischer Vermögen; ergänzt durch Analysen zur Euroclear-Struktur, belgischer Rechtslage und historischen Präzedenzfällen aus den USA und Großbritannien.