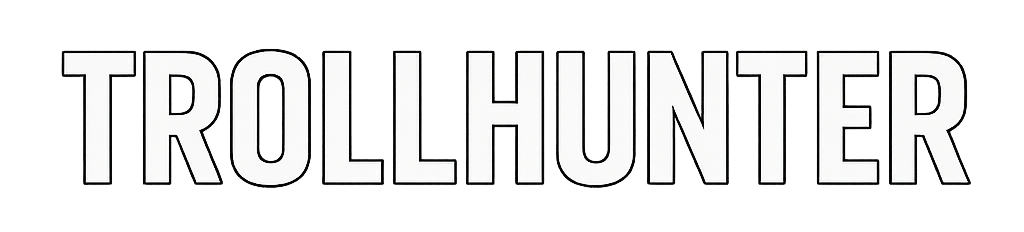Die Welt hat sich gewandelt. Still und leise, aber unumkehrbar. Und Europa? Es dämmert langsam, dass das Spiel, das jahrzehntelang von Washington aus dirigiert wurde, vorbei ist. Der „große Bruder“ im Westen ist nicht mehr der verlässliche Beschützer von einst, sondern ein unberechenbarer Akteur mit innenpolitischen Turbulenzen und außenpolitischer Gleichgültigkeit. Spätestens seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus im Januar 2025 ist klar: Europa steht auf eigenen Beinen. Punkt.
Genau darum ging es kürzlich in einer Analyse des European Council on Foreign Relations (ECFR). Offiziell: Ein Text über Industriepolitik. Tatsächlich: ein politischer Weckruf an die Eliten in Brüssel, Paris und Berlin. Zwischen den Zeilen schreit dieser Text: „Die Amerikaner sind raus – bewegt euch!“
Der ECFR erinnert an etwas, das Europa zu lange vernachlässigt hat: seine industrielle Stärke. Nicht die glänzenden Apps aus Kalifornien, nicht die Cloud-Dienste aus Seattle. Sondern Stahl, Maschinen, Autos, Chemie, Flugzeuge, Schiffe. Dinge, die greifbar sind. Dinge, die im Ernstfall auch zu Verteidigungszwecken genutzt werden können. Das ist keine Nostalgie – das ist strategische Notwendigkeit.
Denn was, wenn die NATO nicht mehr funktioniert? Was, wenn Washington den Schutzschirm einzieht? Was, wenn Europa sich auf Konflikte vorbereiten muss – nicht nur gegen Russland, sondern vielleicht auch gegen wirtschaftliche Erpressung aus China oder protektionistische Maßnahmen aus den USA?
Die Antwort liegt in Europas Fabriken. In der Wiederbelebung einer Industrie, die lange als veraltet und umweltschädlich galt – und die sich nun als Rückgrat jeder ernstzunehmenden Sicherheitsstrategie erweist.
Wer heute noch glaubt, die USA würden im Ernstfall erneut als Retter Europas auftreten, lebt in einer Illusion. Der Isolationismus ist zurück in der amerikanischen Politik. Die Ukraine interessiert dort nur noch am Rande. Europa kann sich nicht einmal sicher sein, ob die Amerikaner ihre eigenen Verteidigungslinien halten würden – geschweige denn unsere.
Selbst aus traditionell transatlantischen Lagern kommen inzwischen Rufe nach „strategischer Unabhängigkeit“. Was früher als französische Marotte galt, wird heute zum europäischen Imperativ. Das ist kein Zufall. Das ist ein Wendepunkt.
Europa ist keine militärische Supermacht. Aber Europa kann produzieren. Und zwar besser als die USA. Mehr Autos, mehr Stahl, mehr Flugzeuge. Airbus hat 2024 doppelt so viele Maschinen ausgeliefert wie Boeing. Europa produziert spezialisierte Schiffe, die den USA längst fehlen. Und während die Amerikaner ihre Werften mit Mühe am Laufen halten, verfügt Europa noch immer über ein industrielles Rückgrat, das nur aktiviert werden muss.
Die EU beschäftigt 30 Millionen Menschen im industriellen Sektor. In den USA sind es gerade mal 13 Millionen. Die Amerikaner schwärmen von Tech-Giganten mit Milliarden-Gewinnen. Aber in Europa liegt das Fundament: Maschinenbau, Chemie, Stahl, Fahrzeugtechnik. Alles, was benötigt wird, wenn aus Wirtschaft plötzlich Verteidigung wird.
Der ECFR-Text macht deutlich: Wer sich verteidigen will, braucht Produktionskapazitäten. Und wer diese nicht selbst hat, macht sich erpressbar. Russland hat Europa gezeigt, wie gefährlich Energieabhängigkeit ist. China droht mit Industriespionage und Preisdumping. Die USA wiederum nutzen Zölle längst als geopolitisches Druckmittel.
Europa muss daher wieder selbst produzieren. Panzer, Drohnen, Flugzeuge, Chips, Rohstoffe, Halbleitertechnik. Nicht alles allein – aber genug, um im Ernstfall standzuhalten. Das ist kein Wettrüsten. Das ist Überlebensstrategie.
Im Text wird die Ukraine nur kurz erwähnt. Aber das ist kein Affront. Das ist Realismus. Der Krieg dort war der Weckruf. Europa hat erkannt: Wenn Kiew fällt, könnten morgen Vilnius, übermorgen Warschau und irgendwann Berlin auf der Liste stehen. Deshalb rüstet Europa nicht nur für die Ukraine – sondern für sich selbst.
Und ja, das ist paradox. Der vielleicht ehrlichste Grund für die europäische Unterstützung der Ukraine ist inzwischen Selbsterhaltung. Das macht sie nicht weniger wichtig. Im Gegenteil: Das macht sie nachhaltiger.
Das neue Europa, das entsteht, ist weniger romantisch. Es glaubt nicht mehr an eine uneingeschränkte „Wertegemeinschaft“ mit Amerika. Es glaubt an Interessen. An Autonomie. Und an harte Produktionszahlen.
Es wird nicht mehr gebettelt, sondern gebaut. Nicht mehr gehofft, sondern investiert. Nicht mehr nur exportiert, sondern auch verteidigt. Europa wird härter, pragmatischer – und entschlossener. Für seine Feinde, aber auch für seine alten Freunde, die sich ihrer Sache zu sicher waren.
Aber – und das ist der Knackpunkt – Europa muss sich jetzt entscheiden. Entweder es erwacht. Oder es verliert sich weiter in internen Streitigkeiten. Über Zuständigkeiten, Subventionen, Schuldenregeln, Quoten, Bürokratie. Dann ist der Moment vorbei. Und mit ihm die Chance, ein wirklich souveräner Akteur zu werden.
Der ECFR-Text sagt nicht alles explizit. Aber seine Botschaft ist klar: „Die Amerikaner haben sich zurückgezogen. Es gibt keinen Plan A mehr. Zeit für Plan B.“
────────────
Quellen und Einordnung:
Der Artikel bezieht sich auf eine aktuelle Analyse des European Council on Foreign Relations (ECFR). Offiziell geht es um Industriepolitik – zwischen den Zeilen aber um viel mehr: Europas sicherheitspolitisches Erwachen nach dem Ende der transatlantischen Illusion. Der Text ist ein stiller Alarmruf an Berlin, Paris und Brüssel: Wenn Amerika sich zurückzieht, bleibt nur Plan B. Und der beginnt in Europas Fabrikhallen.