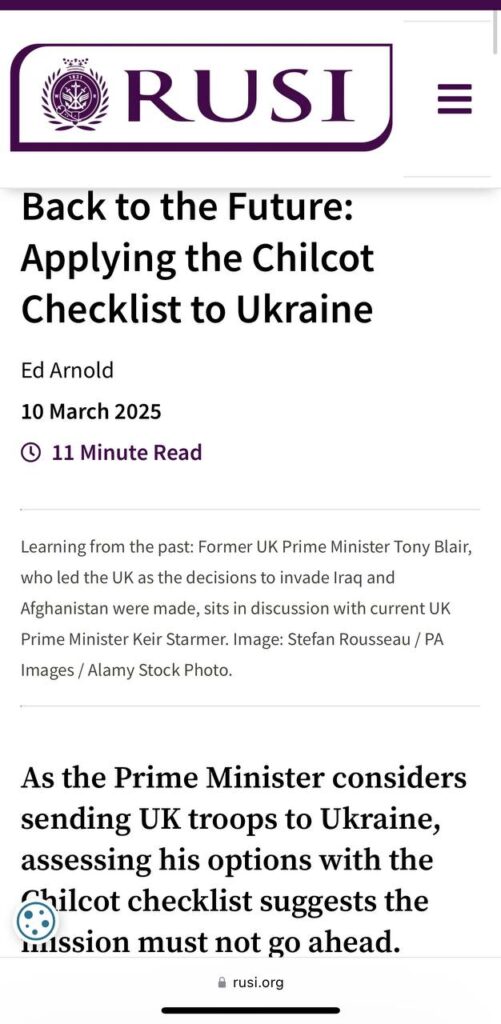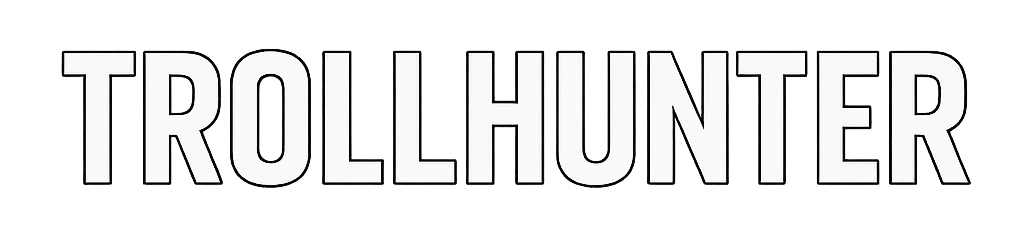Willkommen in der Realität: Die Zeiten, in denen man Kriege aussitzen konnte, sind vorbei. Die Front verläuft nicht mehr irgendwo da draußen, sondern quer durch den politischen Willen Europas. Während die einen noch auf diplomatische Wunder hoffen, stellen andere die entscheidenden Fragen: Was passiert, wenn die Amerikaner aussteigen? Wer hält dann noch die Linie? Und wer ist bereit, mehr zu tun als nur Presseerklärungen zu verschicken?
Ein aktueller Beitrag aus dem britischen RUSI-Institut hat genau deshalb für Nervosität gesorgt. Nicht, weil er etwas besonders Radikales fordert, sondern weil er das Undenkbare auf den Tisch legt: Bodentruppen. In der Ukraine. Nicht im Gefecht, aber präsent. Abschreckung. Sicherung. Stabilisierung. Und plötzlich ist klar: Diese Idee ist nicht mehr tabu. Sie wird durchgerechnet. Politisch vorbereitet. Laut gedacht.
Der Chilcot-Check: Vom Irak ins Jetzt
Der Text arbeitet sich am sogenannten Chilcot-Check ab – einem Fragenkatalog, der nach dem Irak-Desaster entwickelt wurde, um Kriegsabenteuer ohne Ziel und Plan zu verhindern. Zehn Punkte, die jede Intervention bestehen muss: Warum eingreifen? Was soll erreicht werden? Gibt es einen Ausweg? Wer trägt die Last? Was, wenn es schiefläuft?
Und genau hier beginnt die unbequeme Wahrheit: Sechs dieser zehn Fragen sprechen aktuell gegen ein Eingreifen. Aber die vier, die dafür sprechen, sind verdammt gewichtig. Es geht nicht mehr um „Hilfe für die Ukraine“. Es geht um Selbstschutz. Um Glaubwürdigkeit. Um die Frage, ob man bereit ist, Verantwortung für den eigenen Kontinent zu übernehmen.
Kein Vakuum bleibt leer
Denn eines ist sicher: Sollte der Krieg weiter eskalieren, wird es kein Vakuum geben. Entweder füllt es jemand, der bereit ist zu handeln. Oder jemand, der sich alles nimmt, was er kriegen kann. Und wer glaubt, man könne sich dann noch herausreden, hat aus 2021 nichts gelernt. Der Fall von Kabul war kein Betriebsunfall. Es war die Quittung für strategische Abhängigkeit.
Der Text aus London ist deshalb kein Ruf zum Angriff, sondern ein Stresstest. Wie reagiert die Öffentlichkeit? Wie die Medien? Wie die Bürokratien? Kann man eine Idee ins Spiel bringen, ohne dass sofort „Dritter Weltkrieg!“ geschrien wird? Und vor allem: Gibt es irgendwo den politischen Mut, das Undenkbare wenigstens vorzubereiten?
Zwischen Optionen und Verantwortung
Es braucht keine Helden. Aber es braucht Szenarien. Pläne. Argumente. Vorschläge, wie eine militärische Präsenz aussehen könnte, ohne selbst zum Brandbeschleuniger zu werden. Minenräumung. Schutz humanitärer Korridore. Logistische Absicherung. Ausbildung. Präsenz in nicht umkämpften Gebieten. All das ist machbar, verantwortbar, notwendig.
Wer darauf wartet, dass jemand anderes die Initiative ergreift, wird am Ende gezwungen sein, sich einem schlechten Plan anzuschließen – oder zuzusehen, wie andere über den eigenen Kopf hinweg entscheiden. „Koalition der Willigen“ klingt nicht mehr wie Bush-Doktrin, sondern wie Notlösung.
Reden oder handeln
Wer heute nicht handelt, macht sich morgen erpressbar. Und wer glaubt, mit moralischer Empörung gegen Panzer anzukommen, hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Und auch nicht ohne Risiko. Aber wer nur redet und nie handelt, riskiert alles.
Der Feind liest mit. Er analysiert unsere Debatten. Er erkennt Schwäche. Und er wird jede Unentschlossenheit ausnutzen, um die nächste rote Linie zu testen. Und noch eine. Und noch eine.
Denken allein reicht nicht
Deshalb ist es gut, dass solche Texte jetzt geschrieben werden. Sie zeigen: Das Nachdenken hat begonnen. Aber Denken allein reicht nicht. Es braucht auch Entscheidungen. Nicht aus Abenteuerlust, sondern aus Verantwortung. Nicht für andere, sondern für sich selbst.
Die Geschichte wird sich merken, wer bereit war zu handeln. Und wer zu spät kam.